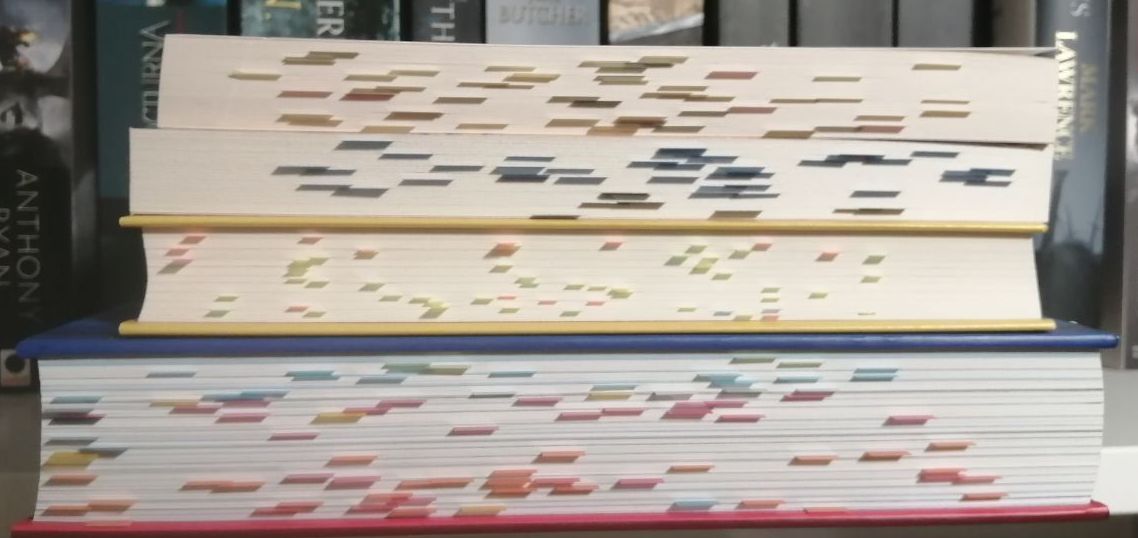Schreiben: Tipps & Analysen - Eine Frage der Perspektive # 1
Das hier ist Teil 1 einer kleinen Serie über Erzählperspektiven. In diesem Blogpost beschreibe ich einige typische Perspektiven, was sie jeweils für die Geschichte bewirken und welche Fallstricke es bei ihrer Nutzung gibt. Was ich hier liefere, ist keine literaturwissenschaftliche Klassifikation (falls ihr eine solche sucht: Genette hat ein System entwickelt, dass die meisten Perspektiven abzudecken scheint), sondern eher eine Unterscheidung der Perspektiven danach, was sie für den Leser bewirken.
1. Person
Es gibt zwar auch Geschichten, die in der zweiten Person geschrieben sind (mir fallen vor allem Beispiele aus dem Kinderbuch-Bereich ein), aber letztlich sind es die erste und die dritte Person, die uns meist in Literatur begegnen – auch wenn N.K.Jemisin in ihren „Broken Earth“-Büchern einige sehr interessante Dinge mit der 2. Person anstellt.
Erzählen in der ersten Person trägt uns in den Kopf eines Charakters, limitiert aber auch das Wissen des Lesers darauf, was der Charakter weiß. Die Welt erreicht uns durch seine Wahrnehmungen gefiltert.
Mögliche Varianten sind:
1. Leser*innen erleben live mit, was die Figur denkt und fühlt. Das wird manchmal noch durch Erzählen im Präsens verstärkt. Ein Beispiel dafür ist Suzanne Collins „Die Tribute von Panem“. In diesem Fall ist der Figur nicht bewusst, dass sie einen „blinden Passagier“ in ihrem Kopf hat. In „Die Tribute von Panem“ führt das dazu, dass man nicht das Gefühl hat, der Schilderung vergangener Ereignisse zu lauschen, sondern sich mitten im Geschehen glaubt – und nicht sicher ist, ob die Figur überleben wird.
2. Die Figur liefert einen eindeutig an ein mehr oder weniger klar definiertes Publikum gerichteten Live-Kommentar – zumindest ist das das Gefühl, dass die Lektüre von Büchern wie „The Dirty Streets of Heaven“ von Tad Williams oder „Food of the Gods“ von Cassandra Khaw weckt (auch wenn es natürlich sein kann, dass die Figuren trotzdem im Rückblick erzählen, schließlich stehen die Geschichten im Präteritum, hat die Art, wie erzählt wird, eine gewisse Unmittelbarkeit). Dieser Effekt wird gerne für sarkastische Kommentare zum Geschehen oder aber für Beschreibungen und Erklärungen genutzt (mit Letzteren kommt man als Autor*in deutlich leichter davon, wenn sie durch die einzigartige Stimme eines Charakters gefiltert sind und genauso viel über die Figur wie das Objekt ihrer Aufmerksamkeit verraten).
Manchmal geht das mit einem Bruch der Vierten Wand einher. Mir fällt gerade kein gutes literarisches Beispiel ein, also nenne ich hier einfach mal die Deadpool-Filme (wo dieses Stilmittel nicht nur für eine Reflektion des Superhelden-Genres genutzt wird, sondern zum Teil auch, um die Leser, mit denen der Protagonist in einen verschwörerischen Dialog tritt, auf dessen Seite zu ziehen).
3. Die Figur erzählt rückblickend einem Publikum, mit dem sich der Leser unwillkürlich identifiziert, oder sogar zum Leser selbst. Ein Beispiel wäre Moshin Hamids „The reluctant fundamentalist“ (das auch Elemente des Erzählens in der zweiten Person hat, wird der Leser doch in die Rolle des Amerikaners gedrängt, dem Changez seine Lebensgeschichte erzählt) oder Jacqueline Careys „Kushiel“, wo Phèdre rückblickend von ihren Erlebnissen berichtet, Vorausdeutungen macht und erklärt, wie sie die Ereignisse im Nachhinein interpretiert, auch wenn die hier implizierte Kommunikationssituation seltsam diffus ist.
Erzählen in der ersten Person hat einige interessante Effekte. Zum Einen schafft es große Nähe zum erzählenden Charakter und verleitet Leser zur Identifikation mit ihm. Das ist meiner Meinung nach – zusammen mit dem Charisma und der fesselnden Erzählstimme des Protagonisten – der Grund, wieso Mark Lawrence‘ „Broken Empire“-Reihe so gut funktioniert. Sein Protagonist ist eine schreckliche Person, aber sein Kopf ist gleichzeitig ein ziemlich faszinierender Ort. Ich vermute, dass die minimal größere Distanz, die ein Erzählen in der 3. Person bewirkt, bei vielen Leser*innen dafür gesorgt hätte, dass die Abscheu gegenüber der Faszination überwiegt. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, wieso gerade Anti-Helden gerne in der ersten Person geschrieben werden, wirken ihre Handlungen doch von außen oft so fragwürdig, dass Leser*innen alle Sympathie mit ihnen einbüßen könnten.
Das Erzählen in der ersten Person bietet auch viele Möglichkeiten zum unzuverlässigen Erzählen. Wenn eine Dialogsituation besteht, hat die erzählende Figur natürlich ein Motiv dafür, die Ereignisse in einem bestimmten Licht erscheinen zu lassen und das Publikum/ die Leserschaft haben einen guten Grund, seine Worte zu hinterfragen. Aber er oder sie muss nicht einmal aktiv lügen. Selbst als „blinden Passagieren“ im Kopf einer Figur stellt sich Leser*innen die Frage, wo die blinden Flecken dieser Figur sind, was sie nicht sehen kann oder will, inwiefern Vorurteile ihre Wahrnehmung filtern oder verzerren und ob sie sich nicht hin und wieder selbst belügt, was ihre Situation oder ihre Motivation betrifft. (Hier ein etwas nerviges Beispiel: Protagonistin: „Neeeeein, ich finde den umschwärmten Badboy überhaupt nicht attraktiv!“, Leser*in: „Ach, halt die Klappe, ich weiß genau, dass ihr nach vielen Missverständnissen am Ende des Buches ein Paar sein werdet.“)
Normalerweise haben Bücher, die in der ersten Person geschrieben sind, nur eine Figur, aus deren Perspektive geschrieben wird, auch wenn es natürlich Abweichungen davon gibt. So bestehen Jonathan Strouds „Bartimäus“-Romane aus 2-3 Handlungssträngen: Bartimäus‘ Perspektive wird in der ersten Person geschrieben, die der beiden anderen Perspektivträger in der dritten. Und in Gordon Kormans „Masterminds“-Serie erzählen mehrere Kinder abwechselnd aus der Ich-Perspektive, was gut funktioniert, weil sich ihre Stimmen und ihre Weltsicht so unterscheiden, dass man sie wahrscheinlich selbst dann hätte identifizieren können, wenn ihre Namen nicht über ihren jeweiligen Kapiteln gestanden hätten.
Das ist eine der großen Stärken des Erzählens in der ersten Person: Es macht es leichter, einer Figur eine individuelle (oft humorvolle) Erzählstimme zu geben und diese Figur wirklich gut kennenzulernen. Allerdings liegen hier auch die Beschränkungen dieser Erzählweise, denn auch wenn Leser*innen hier und da durchschauen können, wenn das Urteil einer Figur getrübt ist und vor ihr zu bestimmten Schlüssen gelangen, bleibt ihnen alles verschlossen, was in den Köpfen anderer Figuren passiert oder wovon der Ich-Erzähler nichts wissen kann.
Z.B. in epischer Fantasy, in der es eine große Rolle spielt, verschiedene Teile und Aspekte der Welt zu erkunden und zu erklären, was Menschen auf verschiedenen Seiten eines Konflikts motiviert, kann sich ein Ich-Erzähler, bei all den Möglichkeiten zu Introspektion, unzuverlässigem Erzählen und sarkastischen Kommentaren, als eine große Einschränkung erweisen.
3. Person: allwissend vs. neutral vs. personal (third limited)
Wenn viele verschiedene Perspektiven abgedeckt werden sollen oder eine gewisse Distanz der Leserschaft zum Geschehen intendiert ist, bietet sich Erzählen in der dritten Person an. Hier gibt es Abstufungen in der Nähe zu den Charakteren und darin, was der Leser weiß.
Ein neutraler Erzähler sieht z.B. alles, aber gibt keinen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der handelnden Personen. Leser*innen müssen ihre Schlüsse aus ihren Handlungen ziehen. Diese Erzählweise zieht sich vergleichsweise selten durch ein ganzes Buch, kommt aber manchmal in Prologen zum Einsatz (z.B. ist der Prolog von „City of Ashes“ aus einer neutralen Erzählperspektive geschrieben, um die Identität einer der beiden handelnden Figuren geheimnisvoll zu halten, während der Rest des Buches sich der personalen Erzählweise bedient).
Ein allwissender Erzähler dagegen weiß, was in den Köpfen aller seiner Figuren vor sich geht, kennt ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Oft erweckt er den Eindruck spöttischer Distanz zum Geschehen, was gerade in humorvollen Büchern ein intendierter Effekt sein kann, aber auch in Leser*innen eine gewisse Distanz hervorrufen und ihre emotionalen Reaktionen auf das Geschehen dämpfen.
Die Perspektive, die uns am häufigsten begegnet, ist die personale. Allerdings finde ich den englischsprachigen Begriff „third limited“ deutlich besser, weil er genau beschreibt, was diese Perspektive bewirkt: Der Autor/ die Autorin schreibt in der dritten Person über einen Charakter und was er wahrnimmt, denkt und fühlt, limitiert und färbt die Beschreibung des Geschehens. Wir sehen nicht, was sich an einem anderen Ort zuträgt und nehmen Gegenstände in der Reihenfolge war, in der auch die Figur sie sehen würde.
Zwar ist die Distanz ein wenig größer als beim Erzählen in der ersten Person, aber trotzdem folgt die „Kamera“, die die Ereignisse für uns aufzeichnet, dem Blick der Figur und neben klar als Gedanken oder unausgesprochenen Worten der Figur markierten (Teil-)Sätzen, die z.B. kursiv geschrieben sein können, stehen doch Sätze und Formulierungen im Text, die sehr nahe an dem Denken und Fühlen des Charakters dran sind.
Natürlich kann auch personales Erzählen relativ distanziert sein, aber in der Praxis erscheint das oft eher als Schwäche des Erzählens. Figuren, über die in der dritten Person geschrieben wird, haben nicht die unverwechselbaren Erzählstimmen von Ich-Erzählern, weil ihr Bewusstseinsstrom sich gewissermaßen mit dem einer externen Erzählinstanz mischt, aber dennoch sollten sie sich klar voneinander abgrenzen und z.B. dabei, worauf sie in ihrer Umwelt achten, andere Prioritäten setzen, und sich auch in der Sprache ihrer Abschnitte/ Kapitel subtil unterscheiden.
Der Wechsel zwischen verschiedenen personalen Perspektiven ist oft durch Leerzeilen oder Kapitelanfänge markiert, muss es aber nicht sein. Ein Beispiel für Perspektivwechsel im Fließtext ist „Mrs. Dalloway“ von Virginia Woolf, wo oft Objekte, die zwei Personen gleichzeitig betrachten, zum Angelpunkt für einen Perspektivwechsel werden. Die verschiedenen Reaktionen, die sie in ihren beiden Betrachtern hervorrufen, vertiefen noch die Einzigartigkeit von deren Stimmen und Persönlichkeiten, die das Narrativ durchdringen. „Mrs. Dalloway“ ist ein gutes Beispiel für eine 3-Person-Perspektive, die sich sehr wie die von Ich-Erzählern anfühlt.
In der Perspektive bleiben
Verschiedene Erzählweisen eignen sich für verschiedene Geschichten und ich sehe für ihre Verwendung nur eine Faustregel: Wenn erst einmal eine Perspektive etabliert wurde, sollte sie beibehalten werden. Es gibt Beispiele für das erfolgreiche Mischen von erster und dritter Person (Stroud: „Bartimäus“) oder dritter und zweiter (Jemisin: „Broken Earth“), aber Autor*innen, die das machen, sollten dabei sehr genau wissen, was sie tun und sehr früh im Buch klarmachen, wo sie sich hinbewegen und dass das alles Absicht ist.
Was mir Leserin, Autorin und Lektorin als einer der großen Fallstricke erscheint, ist das (versehentliche) Mischen von personalem und allwissendem Erzählen in der dritten Person. Wir haben unsere(n) Protagonisten kennengelernt, wissen, dass die Kamera ihm/ihr/ihnen folgt und was die Figur, in deren Kopf wir uns befinden, gerade weiß – aber plötzlich teilt uns die Erzählinstanz mit, was im Kopf einer anderen Figur vor sich geht, was hinter dem Rücken unseres Perspektivträgers passiert oder was ihm/ihr/* in der Zukunft bevorsteht. Das kann auch auf subtile Weise bestehen. Ein Beispiel wäre ein Satz wie: „Figur X [als Perspektivträger bei personalem Erzählen etabliert] sah die verschlossene Tür mit ihren goldenen Augen an.“
Das klingt zuerst sinnvoll, aber wenn wir uns daran erinnern, dass die Kamera bei einem nahen personalen Erzähler sozusagen dem Blick der Figur folgt und wir nur mitbekommen, worüber sie/er/* gerade nachdenkt, ergibt es keinen Sinn, dass wir nun über ihre Augenfarbe informiert werden. Wie oft denkt ihr beim Lesen darüber nach, dass es z.B. blaue oder bebrillte Augen sind, die ihr über den Text gleiten lasst? Die Figur hat in dieser Szene keinen Anlass, über ihre Augen nachzudenken.
Gleichzeitig erfüllen solche Sätze auch einen Zweck, denn wenn Leser*innen eine Figur erst spät aus der Perspektive eines anderen Charakters erleben, kann es gut sein, dass sie sich schon eine Vorstellung von ihr gebildet haben und dadurch, dass sie sich z.B. ihre Augen braun vorgestellt haben, sie aber in Wirklichkeit golden sind, schlimmer aus dem Lesefluss herausgerissen werden als durch den kleinen Bruch mit der etablierten Perspektive. In solchen Momenten gilt es, abzuwägen, was das kleinere Übel ist.
Tatsächlich ist dieser Verzicht darauf, eine Person von Außen zu zeigen, eine Schwäche vom Erzählen in der ersten Person oder eben bei einem personalen Erzähler, der sehr nahe an seinem Charakter dran ist. Wie vermittelt man in einem solchen Fall, wie die Person aussieht, ohne auf das gefürchtete „Ich betrachte mich im Spiegel und beschreibe mein Gesicht im Detail“ zurückzugreifen? Wie schildert man, wie episch die Protagonistin aussieht, als sie sich mit wehendem Mantel und magischen Flammen in beiden Händen in den Kampf stürzt, obwohl ihr Äußeres in dieser Situation wahrscheinlich das Letzte ist, woran sie einen Gedanken verschwendet?
Doch gleichzeitig haben diese nahen Perspektiven auch große Stärken. Ich kontrastiere beim Schreiben zum Beispiel gerne die Innen- und Außensicht bestimmter Charaktere und finde die Differenz dazwischen, wie sie selbst sich sehen und was andere in ihnen erkennen, oder wie zwei Figuren dieselbe Nebenfigur/ dieselbe Situation völlig anders lesen,spannend. Das ist einer der Gründe dafür, wieso „close third limited“ + mehrere Figuren bisher meine Standarderzählweise war. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, nach dem letzten Band der „Drúdir“-Trilogie einen Roman in der ersten Person zu schreiben.