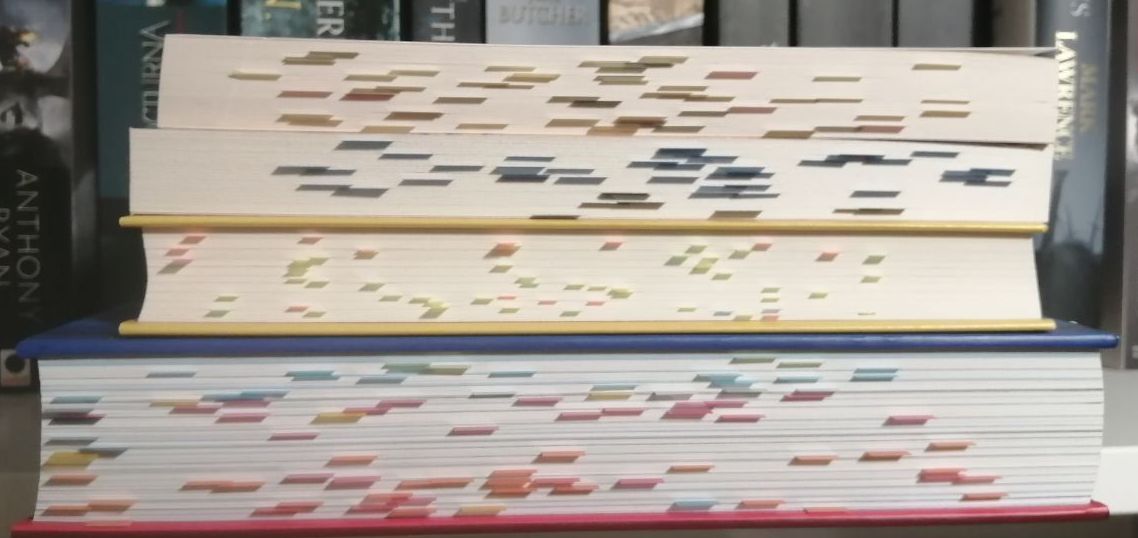Warum lieben Fantasy-Autor*innen Monarchien?

Ich habe – wie eine Menge Leute – die Gelegenheit genutzt, mir auf Youtube legal die erste Episode von „House of the Dragon“ anzusehen. Mein Eindruck: Wer „Game of Thrones“ mochte und gerne mehr davon hätte, was die Serie ausgezeichnet hat, dürfte auch „House of the Dragon“ mögen. Ich persönlich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass das Prequel sich etwas weniger nach „Mehr von dieser Sache, die ihr kennt und mögt“ anfühlt, aber das ist nicht so relevant für diesen Artikel. Relevant ist, dass ich dadurch wieder mal darüber nachgedacht habe, wieso so viele erfolgreiche Geschichten im Fantasygenre um Könige, Adelshäuser und Panik um die Thronfolge kreisen.
Fantasy-Literatur hat nach wie vor den Ruf, rückwärtsgewandter als Science Fiction zu sein – vor allem wegen der häufig von der Vergangenheit inspirierten Settings. Ich denke jedoch, dass bei vielen Autor*innen mehr als Nostalgie für eine Vergangenheit, die so nie existiert hat (aber trotzdem gerne von Leuten beschworen wird, die „historische Korrektheit“ fordern) oder die Nachahmung von frühen Klassikern des Genres dahintersteht, dass sie immer wieder Geschichten erzählen, in denen Adlige oder König*innen die großen Entscheidungen treffen.
Ich denke, einer der wichtigsten Gründe dafür ist praktischer Natur: Gerade bei epischer Fantasy geht es um wortwörtlich weltbewegende Konflikte. Aber gleichzeitig ist selbst in den größten Epen nur Platz für eine bestimmte Anzahl von Akteur*innen, deren Charakter und Motive man in voller Tiefe erkunden kann. Und bei Nebenfiguren passiert es schnell, dass Lesende sie nicht mehr auseinanderhalten können, wenn es zu viele von ihnen gibt. Entsprechend bieten sich Settings an, in denen relativ wenige Schlüsselfiguren statt größeren Gremien wichtige Entscheidungen treffen. Auch lassen sich Entscheidungsprozesse einzelner Menschen oft besser dramatisch inszenieren als die größerer Gruppen oder große gesamtgesellschaftliche Trends (wobei letzteres zum Beispiel Fonda Lee in ihrer „Green Bone Saga“ gut gelingt).
Aber ich denke, es sind nicht nur praktische Erwägungen, die Autor*innen dazu bringen, immer wieder über Königshöfe zu schreiben. Ich hatte erwähnt, dass die existierende literarische Tradition nur ein Faktor von mehreren ist, aber sie ist ein Faktor. Märchen, Sagen, mittelalterliche Epen (sehr bekannt sind zum Beispiel Beowulf oder die immer wieder aufgegriffene Artus-Sage) und nicht zuletzt Klassiker des Fantasy-Genres haben eine starke Tradition von Geschichten rund um (gute) Könige und ihren Hofstaat. Und das ist etwas, das Autor*innen aufgreifen können, entweder, um sich in diese Tradition einzureihen, oder aber um sie zu dekonstruieren.
Letzteres ist relativ einfach und gibt auch gute Geschichten ab. Denn einer der Gründe, wieso Monarchien und Aristokratien (oder so ziemlich jede Situation, in der eine inkompetente oder unsympathische Person unverdient Macht hat und missbrauchen oder einfach nur ungeschickt einsetzen kann) einen so guten Hintergrund für Geschichten abgeben, ist eben, dass sie massive Probleme und eine Menge Konfliktpotenzial abgeben. Erbfolgestreitigkeiten, unfähige Herrschende, die völlig unqualifiziert für ihre Position sind und dergleichen liefern eine Menge Plotpunkte. Ich hatte ja schon einen Blogpost darüber geschrieben, dass Geschichten häufig einen Teil ihrer Spannung daraus beziehen, dass es Figuren in Rollen verschlägt, für die die sie ungeeignet sind oder in die sie zumindest erst hineinwachsen müssen. Ein Setting, in dem Macht vererbt wird, beschwört eine Menge dieser Situationen herauf.
Ich würde allerdings daran zweifeln, ob Autor*innen, die in ihren Büchern demonstrieren, wieso eine starr stratifizierte Gesellschaft mit sehr mächtigen Individuen an der Spitze nicht so toll ist, damit per se etwas Subversives oder Gesellschaftskritisches machen. Ich glaube nicht, dass eine relevante Anzahl von Menschen noch an Monarchie als das überlegene System glaubt, sodass ein Buch, das illustriert, wieso man nicht naiv auf den „guten König“ vertrauen sollte, wahrscheinlich eher so eine „haha, gut dass wir weiter sind“-Reaktion und wenig Nachdenken über die Gegenwart hervorruft. Erfolgreicher darin, sich als Fantasy-Geschichte kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, fand ich zum Beispiel den Film „The Shape of Water“, der sich die häufig von konservativeren Teilen der Gesellschaft idealisierten 50er-Jahre vorknüpft.
Ich glaube also nicht, dass es zwangsläufig ein Ausdruck von Sehnsucht nach einer vermeintlich einfacheren Vergangenheit ist, wenn Fantasy- (und auch einige Science-Fiction-)Autor*innen über Herrscherdynastien und Adelshäuser schreiben. Und wie so ziemlich jeder Gegenstand von Literatur kann dies je nach Ausführung spannend oder uninteressant sein. Es gibt einige Fantasyromane, die um König*innen und ihre Angehörigen kreisen, die ich sehr mag – Anfang des Jahres konnte mich zum Beispiel Tad Williams mit „Die Hexenholzkrone“ beeindrucken, einem Roman, in dem sich unter anderem ein älteres Königspaar sich damit abfinden muss, dass sie die nächste Generation nicht werden beschützen können.
Ich finde es aber trotzdem immer sehr erfrischend, wenn mir in einem Buch mal ein anderes System begegnet und wenn ich vor allem das Gefühl habe, dass Dinge in Bewegung sind. Hier fallen mir zum Beispiel die „Dandelion Dynasty“-Romane von Ken Liu ein, in denen Rebell*innen einen Kaiser stürzen und nun herausfinden müssen, wie sie besser mit der Macht umgehen. Oder die verschiedenen Herrschaftssysteme, die sich in „Die 13 Gezeichneten“ von Judith und Christian Vogt begegnen. Oder die blutigen Anfänge einer Republik, die Leser*innen in Brian McClellans „Promise of Blood“ beobachten. Oder die verschiedenen Nationen, die in Seth Dickinsons „The Masquerade“-Reihe mit dem Expansionswillen der „imperial republic of Falcrest“ konfrontiert sind (wirklich, lest diese Bücher – sie ziehen teilweise sehr runter, aber sind gleichzeitig so gut).
Mein Fazit: Es ist nicht per se ein Zeichen von Rückständigkeit oder politisch fragwürdig, wenn Fantasy-Autor*innen über Monarch*innen und Adlige schreiben und diese sind in mancher Hinsicht sehr praktisch fürs Erzählen (ein Grund, wieso Weltraum-Feudalismus auch bei Science-Fiction-Autor*innen beliebt ist – er kann in solchen Settings aber auch als eine Warnung vor der Verfestigung wirtschaftlicher und politischer Machtasymmetrien fungieren).
Es kann sich aber auch lohnen, darüber hinauszudenken und sich entweder selbst andere Systeme auszudenken oder in der Geschichte nach Beispielen dafür zu suchen. Ich habe beispielsweise vor einer Weile eine sehr spannende Biographie über Niccoló Machiavelli („Be like the fox“ von Erica Benner) gelesen und bin dadurch an die interessante Geschichte von Stadtstaaten während der Renaissance erinnert worden.